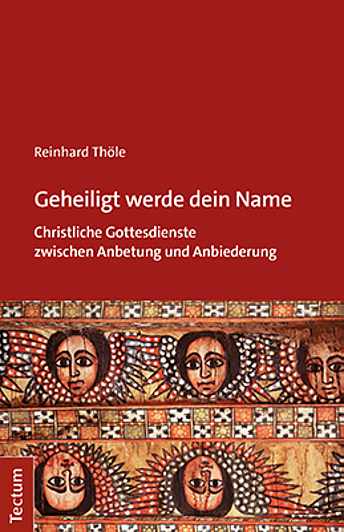
Reinhard Thöle: Geheiligt werde dein Name
Eine Buchbesprechung mit aktuellem Anlass
Lex orandi lex est credendi — Das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens.“ So lautet eine alte theologische Regel, die sinngemäß mindestens bis auf Prosper von Aquitanien zurückgeht (legem credendi lex statuat supplicandi, Migne PL 51,209). Was eine Kirche zu beten lehrt, das lehrt sie auch zu glauben. Was eine Kirche betreffs ihrer Liturgie anordnet, ist ein sicherer Anhaltspunkt für ihre Dogmatik. Im Umkehrschluss: Wo der Glaube an christliche Grundwahrheiten verdunstet, wird das Allerlei liturgischer Belanglosigkeit nicht fern sein — und umgekehrt.
Eine ebenso konzise wie tiefschürfende — und trotz des gewichtigen Inhalts sehr gut lesbare — konfessionsübergreifende Analyse liturgischer Abirrungen sowie ihrer Hintergründe hat jüngst Professor Dr. theol. habil. Reinhard Thöle veröffentlicht. Thöle, vormals Direktor des Seminars für Ostkirchenkunde der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, gehört zu den bedeutendsten akademischen Experten für Ostkirchenkunde im deutschen Sprachraum. Seine vielfältige ökumenische Erfahrung und seine jahrzehntelange tiefe Vertrautheit mit dem byzantinischen Ritus (und mit den orientalischen Riten) versetzen ihn in die Lage, aktuelle liturgischen Entwicklungen in den christlichen Konfessionen sowohl aus der Innen- als auch aus der Außenperspektive vergleichend zu analysieren.
Thöle betrachtet dabei besonders kritisch sowohl den nachkonziliaren römisch-katholischen Ritus (Novus Ordo) als auch das liturgische Spektrum des in den evangelischen Landeskirchen organisierten Neuprotestantismus, das sich aus dem Evangelischen Gottesdienstbuch von 1999 ergibt. Dieses liturgische Spektrum bezeichnet er auch als „Neo-Usus“ (S. 89) in Abgrenzung von den traditionellen, in der Reformationszeit entstandenen und überwiegend die westliche Liturgietradition organisch fortschreibenden lutherischen Liturgien. Insoweit er alles Mögliche an heiligen und weniger heiligen Texten und Riten integrieren und vermischen kann, ist der Neo-Usus „die liturgische Symphonie der protestantischen Individualisten und Spezialisten“ (90).
Es ist diese besondere Unverbindlichkeit und Offenheit, welche den Novus Ordo und noch mehr den neuprotestantischen „Neo-Usus“ im Vergleich zu allen älteren liturgischen Formen kennzeichnet. Der Eindruck drängt sich auf, dass dies das liturgische Korrelat eines religiösen Relativismus oder gar Indifferentismus darstellt. Ihre Grenze findet diese Unverbindlichkeit jedoch in dem unübersehbaren Unwillen zur Bewahrung tradierter Formen, in denen die „vertikale“ Dimension des Gottesdienstes als dialektisch-dialogisches Geschehen zwischen Gott und Mensch zum Ausdruck kommt. So ist die Zelebrationsrichtung versus populum nur eine Kann-Bestimmung in der Allgemeinen Einführung zum Römischen Messbuch und verdankt sich überdies dem mittlerweile überwundenen Irrtum, die gemeinsame Gebetsrichtung von Zelebrant und Gläubigen ad orientem sei in der christlichen Antike nicht die Norm gewesen. Dennoch ist und bleibt die Zelebration mit dem Rücken zum Hochaltar das ikonographische Charakteristikum des Novus Ordo wie auch des von diesem „inspirierten“ Neo-Usus. „Offensichtlich sind die äußerliche und die innere Ausrichtung des Gebetes nicht mehr kongruent. Es […] wird deutlich, dass das, was man sagt, nicht getrennt werden kann, von dem, was man tut“ (61).
Hinzu kommt im Novus Ordo die Option eines gänzlich selbst erdichteten Eucharistiegebetes („Hochgebet III“), das im Unterschied zum „Hochgebet I“ (Canon Romanus), „Hochgebet II“ (abgewandelte Traditio apostolica) und „Hochgebet IV“ (sehr stark gekürzte und überarbeitete Basilius-Anaphora) in keiner historischen Liturgie wurzelt. Aus altkatholischer Sicht sei hier angemerkt: Durch die Approbation des Missale Romanum von 1970 hat die römische Hierarchie einmal mehr die Rolle der treuen Bewahrerin der Tradition aufgegeben und sich als deren eigensinnige Herrin geriert. Die architektonische Verunstaltung historischer Kirchen durch den meist disharmonischen Kontrapunkt von „Volksaltar“-Ambo-Ensembles ist folgerichtiger Teil dieses liturgischen Abrissunternehmens. Dazu gehört auch die weitestgehende Tilgung des gregorianischen Chorals und dessen Ersetzung durch „vermeintlich eingängige, hölzern daherkommende deutschsprachige Kehrverse“ (58). Letztere widerspricht übrigens ebenso wie die gänzliche Verdrängung der lateinischen Sprache dem erklärten Willen des Zweiten Vatikanischen Konzils (vgl. z.B. SC, 36, 54, 116).
Was ist alledem positiv entgegenzusetzen: Zunächst und vor allem die Einsicht, dass die „geistliche Grundgestalt“ der Eucharistiefeier „ererbt“ und „geschenkt“ ist, mithin etwas dank göttlicher Vorsehung Vorgefundenes. Reinhard Thöle beschreibt sie als liturgia abscondita, als verborgene Liturgie, die einen Offenbarungscharakter in sich trägt. In ihr findet ein Offenbarungsgeschehen statt, zu dem das Gedächtnis der Heilstaten Gottes (Anamnese) und die Herabrufung Seines Geistes (Epiklese) ebenso wie die Darbringung an Ihn und die Feier Seiner Gegenwart im Leib Christi gehören (120). „Die im Unterbewussten vorhandene Empfängnisfähigkeit der Seele kann sich von Natur aus mit der sich offenbarenden eschatologischen Dimension des Gottesdienstes vereinigen. Dies ist das verborgene Fundament, auf dem das Gebäude des öffentlichen Gottesdienstes errichtet wird.“ (121)
Deshalb stellt Thöle fest, unter Verweis auf eine Bemerkung des römisch-katholischen Ostkirchenkundlers Michael Schneider (Sakrament, 297): „Das schwierigste Werk der Kirche ist die Feier des heiligen Gottesdienstes. ‚Keiner kann im Glauben mehr erfahren, als er in der Liturgie feiert'“ (161). Denn, mit dem rumänisch-orthodoxen Religionswissenschaftler Mircea Eliade gesprochen „gehört der Gottesdienst in den Bereich der Hierophanie und Theophanie“ (167). Der Gottesdienst ist ein dialektisches Geschehen, insoweit es sich um die zutiefst asymmetrische Begegnung zwischen Gott und Mensch handelt. Darin liegt die Verheißung und existenzielle Bedeutsamkeit des christlichen Gottesdienstes: „Gefährlich ist es, Gott im Gottesdienst zu begegnen. noch gefährlicher ist es, ihm im Gottesdienst nicht [mehr] zu begegnen.“ (166)
Trotz der überschaubaren Länge (178 S. mit Literaturverzeichnis) dieses sehr einladend geschriebenen Buches ist es hier nicht möglich, all die vielen darin enthaltenen wertvollen Gedanken auch nur summarisch wiederzugeben. Reinhard Thöle lässt den Leser teilhaben an seiner tiefgehenden akademischen Fachkenntnis, seinem jahrzehntelangem Erfahrungsschatz in der Ökumene, einem sehr großen intellektuellen Weitblick und erstaunlichem geistlichen Tiefgang. Geheiligt werde dein Name sollte in keinem Bücherschrank derer fehlen, denen Gottesdienst „am Herzen“ liegt.
[F.I.H.]

