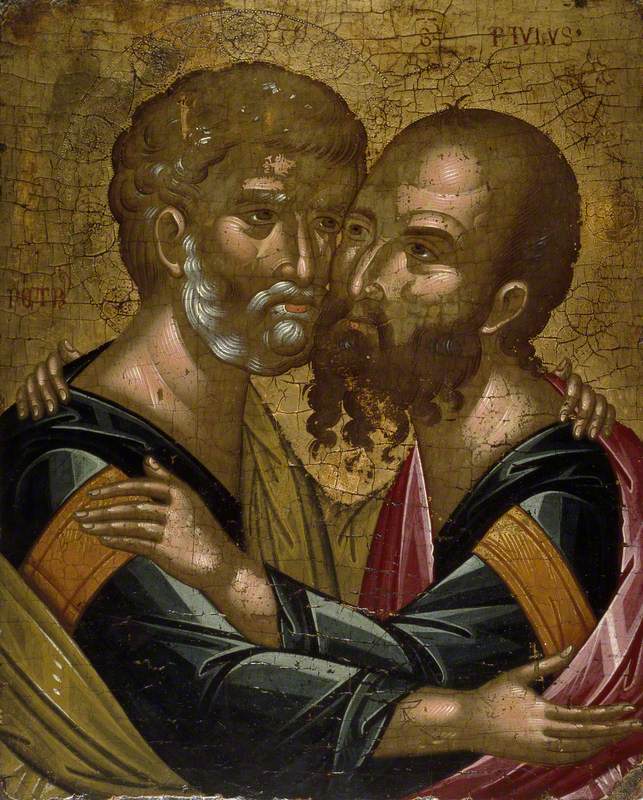Herzlich willkommen bei der Nordisch-katholischen Kirche in Deutschland!
Die Nordisch-katholische Kirche steht für den orthodoxen Glauben der Kirche des ersten Jahrtausends und die liturgische Tradition der Westkirche.
Sie wird geleitet von Bischof Ottar Mikael Myrseth (Bergen/Norwegen) und gehört zur altkatholischen Union von Scranton unter Leitung von Erzbischof Dr. Anthony Mikovsky (Scranton/Pennsylvania).
Diese Seiten informieren Sie über unseren Glauben, unsere Geschichte, unsere Gottesdienststandorte, unsere Buchpublikationen und unser diakonisches Förderwerk; auch unser liturgischer Kalender sowie ein Verzeichnis unserer Seelsorger sind hier abrufbar.
Seien Sie uns herzlich willkommen!
Hier geht es zum Archiv aller Beiträge.